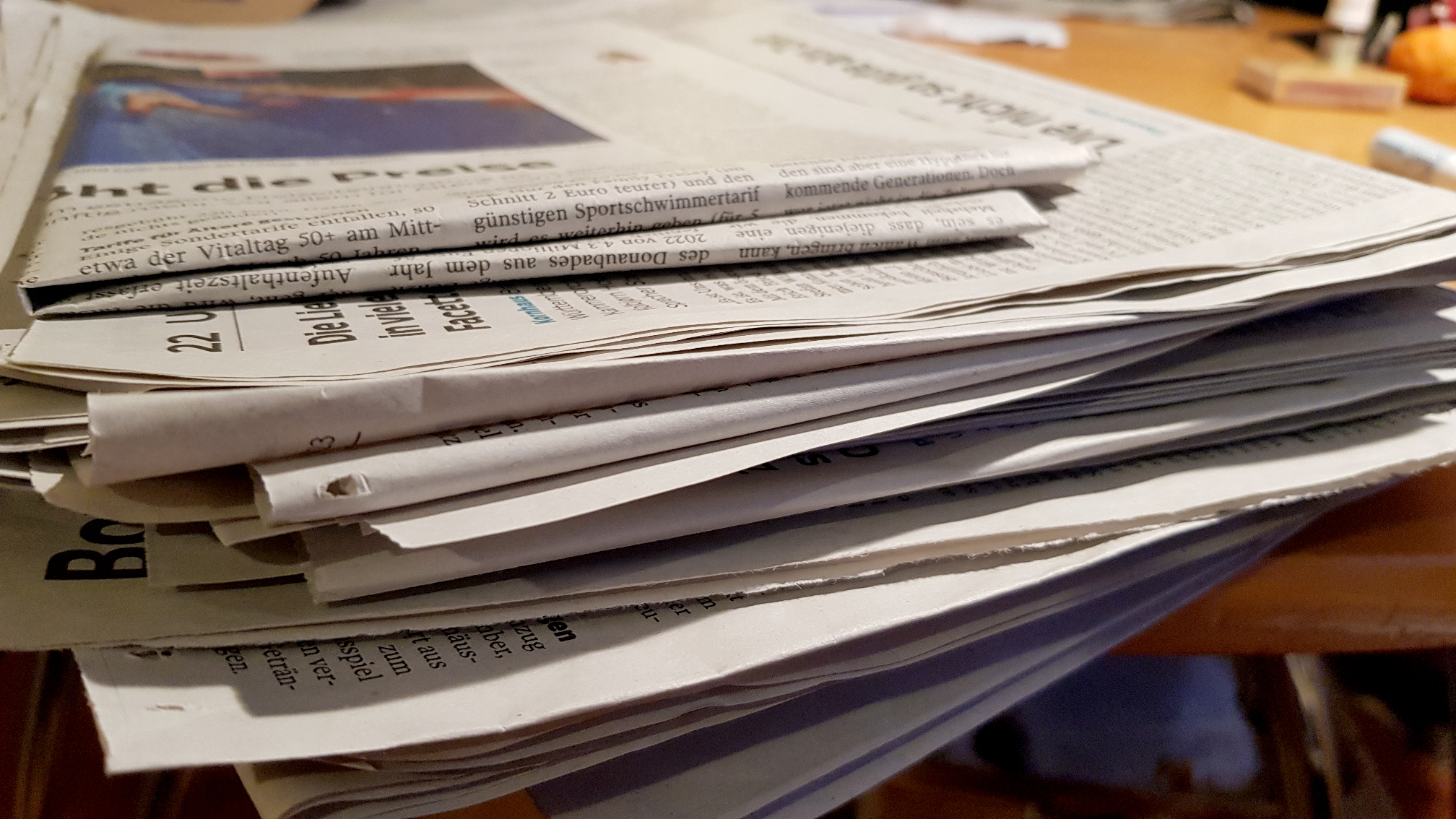Wer zahlt die Zeche für die Billig-Klamotten? Umweltpädagogin Sonia Müller zeigt den Schülerinnen und Schülern Einblicke die Kehrseite der Fast Fashion.
Foto: Uli Landthaler
Der hohe Preis der billigen Klamotten
Was steckt hinter der Zwanzig-Euro-Jeans? Ein Schulbesuch mit der Umweltpädagogin Sonia Müller, sie ist unterwegs im Auftrag des Landratsamtes in Sachen Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit
Fast jede/r hat einen gut gefüllten Kleiderschrank. Die Schülerinnen und Schüler der Hauwirtschaftsklassen der Weihungstalschule in Staig machen da keine Ausnahme. Die Acht- und Neuntklässer rechnen vor, was sie alles haben. Eine bringt es auf 26 T-Shirts, eine andere auf 25 Pullover, alle haben in der Regel fünf bis zehn Jacken im Schrank und um die fünf Paar Schuhe. Aber was brauchen sie davon wirklich? „Es gibt Erhebungen, nach denen 80 Prozent der Kleidung gar nicht getragen werden“, berichtet Umweltpädagogin Sonia Müller und sorgt damit für Staunen im Klassenzimmer. Sie kennt das Phänomen ja auch selber: „Man kauft hier mal was und da mal was, und irgendwann ist der Schrank voll.“ Tatsächlich angezogen werden nur ein paar Lieblingsstücke. Was hingegen günstig gekauft wird, verschleißt auch schnell: dünner Stoff, schwache Nähte – und schon bald ein Kandidat für den Altkleidercontainer. Und die können die Massen an schnell wieder weggeschmissenen Billigklamotten kaum noch aufnehmen.
Sonia Müller und ihre Kollegin Margarete Kienle sind im Auftrag des Landratsamts im Alb-Donau-Kreis unterwegs, um Schülern im Unterricht das Thema Nachhaltigkeit, Mülltrennung und Abfallvermeidung nahezubringen. In den Hauswirtschaftsklassen der Weihungstalschule geht es an diesem Vormittag um die Frage „Billige Kleidung – aber zu welchem Preis?“ Stichwort: Fast Fashion. Das bedeutetet containerweise Billigklamotten aus Fernost, produziert etwa von Näherinnen in Bangladesch, die von umgerechnet 40 Euro im Monat und weniger leben müssen – so viel, wie einige der Schüler an Taschengeld bekommen.
„Was zahlt Ihr so für ein T-Shirt“, will die Umweltpädagogin wissen. Zwanzig Euro werden genannt, fünf Euro, zwei Euro - „das war reduziert bei New Yorker“. „Und wo sind eure Sachen her?“ Die angehenden Hauswirtschafter untersuchen die Etiketten. China, Tunesien, Türkei, Bangladesch. „Hat jemand was aus Deutschland“? Eine Hand hebt sich.
Also geht es um eine Vorstellung davon, welchen Weg die günstige Mode nimmt, bis sie bei uns im Laden liegt. Welche Strecke legt zum Beispiel eine Jeans zurück, bevor sie im Bekleidungskaufhaus oder beim Online-Shop im Sortiment landet? Baumwollanbau in Kasachstan, Garnherstellung in der Türkei, Stoffproduktion in Taiwan, Färben in China oder Tunesien, Stoffveredelung in Bulgarien, Nähen in Indien, zum Schluss das Finish für den Stone-Washed-Effekt in Frankeich. Unglaubliche 60.000 Kilometer hat die Jeans so am Ende zurückgelegt, Teile wie Nieten und Futterstoff werden extra importiert. Alles begleitet von schlechten Arbeitsbedingungen und niedriger Bezahlung der Arbeiter/innen sowie problematischen und gesundheitsschädlichen Umweltstandards: Pestizide im Baumwollfeld, lungenschädliches andstrahlen des Stoffes und ein Wasserverbrauch von bis zu 8.000 Litern für die Produktion einer Jeanshose.

Wer verdient an der Kleidung? Sonia Müller hat es auf die Hosenbeine einer Vorführ-Jeans gemalt: Die Hälfte des Kaufpreises geht an den Handel, der Transport kostet ein gutes Zehntel. Die Markenwerbung verschlingt ein Viertel der Einnahmen. Als Lohn für die Arbeiter/innen fällt nur ein Prozent ab, und auch das hält Lehrerin Annika Dirnberger für zu hoch gegriffen. Bei einer bekannten Billigkette gibt es solche Hosen ab 20 Euro.
Was kann man als Käufer da machen? „Nicht nur auf den Preis achten“ sagt Sonia Müller, „auch auf die Langlebigkeit“. Was länger hält, macht sich auch am Ende besser bezahlt, trotz des höheren Preises. Sonia Müller verweist auf ihr schwarz-weiß gestreiftes Oberteil: 49 Euro, ein Lieblingsstück. Und auf ihre Jeanshose, die zum Teil aus recycelten Kunstfasern hergestellt ist.
Als Orientierungshilfe beim Shoppen wirft sie die Gütesiegel an die Wand, an denen sich fair und nachhaltig produzierte Kleidung erkennen lässt: Fairtrade, Fairwear, Global Organic, Grüner Knopf. Letzterer erregt aber schon wieder den Argwohn von Annika Dirnberger: „Die Standards sind nicht gut, diese Sachen gibt es auch bei Lidl“.
Eine andere Möglichkeit sind gebrauchte Klamotten. Von der Freundin, von Geschwistern oder auch aus dem Second-Hand-Shop: Es ist erstaunlich, was es dort an guten und günstigen Sachen gibt, hat Sonia Müller beobachtet.
Nach zwei Stunden Vortrag und Gruppenarbeit haben die angehenden Hauswirtschafter/innen viel mitbekommen über Herkunft, Produktionsbedingungen, Kalkulation und Umweltbedingungen in der Bekleidungsbranche. Was bleibt davon hängen? Viel, sagt Annika Dirnberger: „Es ist für die Schüler immer etwas Besonderes, wenn Externe an die Schule kommen und mit den Schülern ein Thema erarbeiten“. Sie wird an dem Thema dranbleiben.
Info:
Die Abfallwirtschaft Alb Donau-Kreis organisiert für Schulen im Landkreis pädagogische Angebote zum Thema Mülltrennung und -vermeidung. In verschiedenen Klassenstufen geht es in Theorie und Praxis unter anderem um umweltfreundliche Schulmaterialien, Müllvermeidung in der Schule, richtig kompostieren, abfallarm einkaufen und Wissenswertes über den Rohstoff Papier.
Ansprechpartner ist Uli Landthaler unter u.landthaler@aw-adk.de.